💄 Popfeminismus: Wenn Empowerment zur Konsumware wird
- Marie Laveau
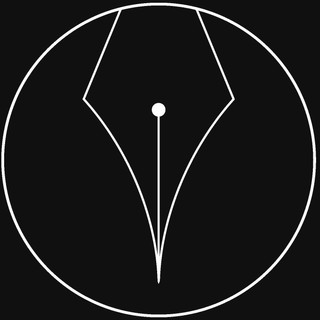
- 17. Juni
- 4 Min. Lesezeit
Ich erinnere mich an einen Moment in meinem Leben, der mich mehr über Feminismus gelehrt hat als jeder Artikel: Ich stand vor dem Schminkspiegel eines Clubs, irgendwo zwischen Lipgloss, lauter Beyoncé-Musik und einem betrunkenen Monolog über „Selbstliebe ist Revolution“. Neben mir weinte eine Freundin, weil ihr Ex-Freund ihre Karrierepläne „süß, aber unrealistisch“ genannt hatte. Eine andere filmte sich für Instagram, mit dem Hashtag #BossBabe. Ich hielt inne, betrachtete die Szene und dachte: Irgendwas an dieser Emanzipation riecht verdächtig nach Parfüm und Kapitalismus.
Willkommen in der funkelnden Welt des Popfeminismus – dort, wo Empowerment als Accessoire verkauft wird, und wo Patriarchatskritik manchmal besser klingt, wenn sie Autotune hat.

👠 Was ist Popfeminismus überhaupt?
Popfeminismus ist der Versuch, feministische Inhalte massentauglich zu machen – übersetzt in die Sprache von Musikvideos, Instagram-Captions und Werbekampagnen. Rihanna singt „Bitch Better Have My Money“, Taylor Swift macht mit „The Man“ Patriarchatskritik tanzbar, und Dove verkauft Body Positivity in Werbespots mit strategisch platzierten Dehnungsstreifen.
An sich ist das keine schlechte Idee. Feminismus muss nicht nur in akademischen Elfenbeintürmen hausen. Er darf in High Heels daherkommen, Lippenstift tragen und dabei laut sein. Feminismus darf Spaß machen. Die Frage ist nur: Was passiert, wenn der Spaß wichtiger wird als der Inhalt?
🪞 Wenn Empowerment zur Inszenierung wird
Popfeminismus lebt von einem bestimmten Narrativ: „Du bist stark. Du bist schön. Du bist genug.“ Es ist ein bisschen wie ein modernes Märchen – nur dass der Prinz durch einen Selfie-Ring ersetzt wurde und das Happy End ein Influencer-Deal ist.
Doch genau hier liegt das Problem: Empowerment wird zur Inszenierung, ein Produkt unter vielen. Echte Gleichberechtigung ist unbequem, fordert Machtverzicht, stellt Systeme infrage. Popfeminismus dagegen bleibt oft an der Oberfläche – weil Tiefgang nicht so gut klickt.
Ein Beispiel: #BodyPositivity. Ursprünglich von schwarzen, queeren Aktivist*innen initiiert, um Diskriminierung sichtbar zu machen, wurde der Hashtag von Unternehmen gekapert. Heute zeigt er vor allem normschöne Influencerinnen, die „mutig“ ihre Cellulite zeigen – gefiltert, natürlich.
🧃 Feminismus als Lifestyle – und seine Nebenwirkungen
In der Popvariante wird Feminismus oft als Lifestyle verkauft – wie veganes Granola oder ein fair produzierter Jutebeutel. Man „lebt“ Feminismus durch Statements auf T-Shirts („The Future is Female“), durch den Kauf feministischer Literatur in ästhetisch arrangierten Buchläden oder durch das Teilen von Emma-Watson-Zitaten auf Pinterest.
Was dabei verloren geht? Der politische Gehalt.
Feminismus ist kein Smoothie, sondern eine politische Bewegung. Er verlangt mehr als Likes und Lippenbekenntnisse. Ein feministisches Leben bedeutet nicht nur, Beyoncé zu hören, sondern auch, sich mit Machtstrukturen auseinanderzusetzen, Privilegien zu hinterfragen, auch wenn’s weh tut. Besonders dann.
📉 Die dunklen Ecken: Wer profitiert eigentlich?
Jetzt wird’s ernst. Denn so hübsch Popfeminismus auf Instagram aussieht – er hat Schattenseiten:
Er reproduziert Konsumlogiken.
Anstatt Patriarchat und Kapitalismus zu kritisieren, werden sie recycelt. Empowerment wird zur Verkaufsstrategie – ob als Parfum, Yogamatte oder Coaching-Paket.
Er schließt viele aus.
Popfeminismus richtet sich oft an weiße, mittelständische, körpernormschöne Cis-Frauen. Die Perspektiven von Schwarzen, queeren, behinderten oder armen Frauen? Fehlanzeige. Intersektionalität ist hier selten mehr als ein Hashtag.
Er täuscht Fortschritt vor.
Wenn man glaubt, dass ein Werbespot mit einer nicht-rasierten Achsel schon Feminismus ist, verliert man das größere Ziel aus dem Blick. Eine feministische Gesellschaft braucht strukturelle Veränderungen, keine PR-Kampagnen.
🎭 Die feministische Performance
Besonders gefährlich wird es, wenn der performative Charakter von Popfeminismus nicht mehr hinterfragt wird. Wenn junge Frauen glauben, sie müssen sexy und selbstbewusst sein, um „richtig“ feministisch zu sein. Wenn Unsicherheit oder Wut als „toxisch“ gelten, weil sie nicht ins bunte Instagram-Feed passen.
Das Patriarchat hat sich nicht in Luft aufgelöst. Es hat sich nur einen neuen Look zugelegt – feministischer Anstrich, dieselbe Unterdrückung. Denn was ist feministisch daran, wenn Frauen zwar die Wahl haben, aber diese Wahl immer wieder in Richtung Selbstoptimierung geht? Wenn man Freiheit nur in Form eines "you-go-girl"-gesponserten Gym-Abos bekommt?
🧨 Was tun? Ein Aufruf zur radikalen Sanftheit
Kritik am Popfeminismus heißt nicht, Spaß zu verbieten oder feministische Icons zu entzaubern. Es geht darum, ehrlicher, tiefer und politischer zu werden.
Wir brauchen Feminismus, der unbequem ist.
Der nicht auf Likes zielt, sondern auf Veränderung.
Wir brauchen Raum für Widersprüche.
Eine Frau darf Lippenstift tragen und Kapitalismuskritik äußern. Aber sie darf auch sagen: „Ich bin müde. Ich will keine Performance mehr.“
Wir brauchen Geschichten, die nicht ins Raster passen.
Von Migrantinnen, von queeren Menschen, von Care-Arbeiterinnen. Feminismus darf nicht nur die Stimme der Starken sein – er muss auch die Ohnmacht ernst nehmen.
🌱 Zum Schluss: Ein kleines Plädoyer
Ich wünsche mir einen Feminismus, der nicht nur in Hochglanz daherkommt, sondern auch in Tränen, in Schweiß, in Gesprächen bei Kaffee und Katerfrühstücken. Einen Feminismus, der nicht nur sagt: „Du kannst alles sein“, sondern auch fragt: „Warum musst du eigentlich alles sein?“
Vielleicht beginnt radikale Veränderung nicht mit einem Instagram-Post, sondern damit, dass wir uns zuhören. Uns verletzlich zeigen. Unsere Widersprüche zulassen. Und ja, vielleicht auch mal auf ein Shirt mit dem Aufdruck „Empowered“ verzichten.
Denn manchmal ist der mutigste Akt in dieser Welt nicht, sich als Boss-Babe zu inszenieren – sondern als Mensch, der ehrlich hinschaut.
📚 Quellen & Weiterführendes
Banet-Weiser, Sarah. Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny. Duke University Press, 2018.
hooks, bell. Feminism is for Everybody. South End Press, 2000.
Gill, Rosalind. "Postfeminist Media Culture: Elements of a Sensibility." European Journal of Cultural Studies, 2007.
McRobbie, Angela. The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change. SAGE, 2009.
Taylor, Keeanga-Yamahtta. How We Get Free: Black Feminism and the Combahee River Collective. Haymarket Books, 2017.











Kommentare